Die unsichtbare Seite von Transformation: Tools und Mindset für nachhaltige Veränderung in komplexen Umfeldern
- Dominique Giger
- 2. Nov.
- 6 Min. Lesezeit
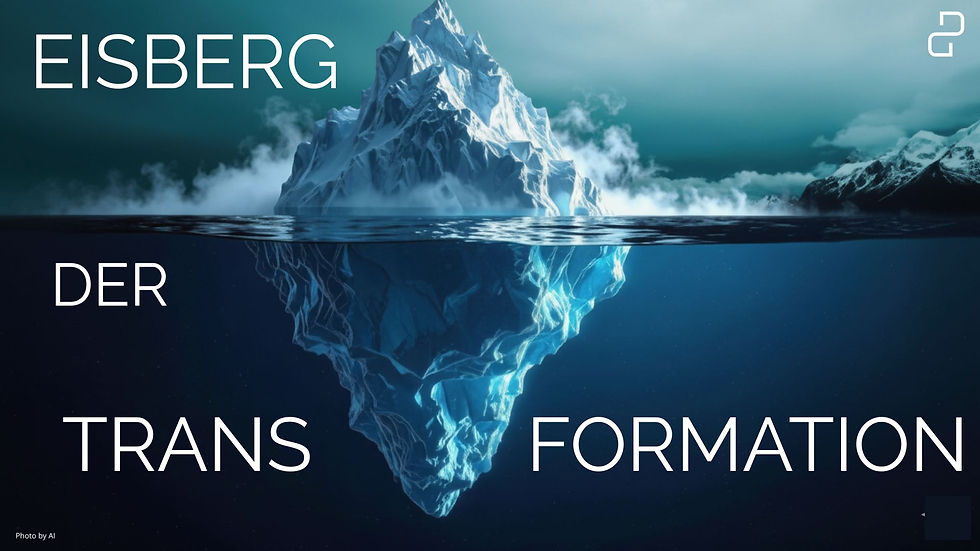
Warum Strategie planen nicht reicht
Organisationen formulieren Strategien, setzen Ziele und investieren in Programme. Und doch scheitern viele Initiativen. Eine oft zitierte Zahl aus der Change-Literatur lautet: Rund 70 % aller Veränderungsprogramme erreichen ihre Ziele nicht. Eine Erkenntnis, die in Beratungs- und Managementkreisen wiederholt genannt wird und die die Dringlichkeit unterstreicht, über die rein strukturellen Aspekte von Transformation hinauszugehen.
Diese Zahl muss aber kritisch gelesen werden: Sie fasst verschiedene Studien, Definitionen von „Erfolg“ und unterschiedliche Untersuchungsgegenstände zusammen. Dennoch ist die Kernbotschaft valide: Viele Veränderungsprojekte scheitern nicht an Technik oder Strategie, sondern an der menschlichen Dimension: an Wahrnehmungen, Emotionen, Machtstrukturen und an einem fehlenden Lern-Mindset. Dieser Artikel befasst sich mit den unsichtbaren, machtvollen Faktoren, stellt erprobte Modelle vor und formuliert konkrete Handlungsfelder für Führungskräfte.
Das Unsichtbare sichtbar machen: vier organisationalen Biases
Aus dem Praxisalltag lassen sich mehrere wiederkehrende Vorurteile (Biases) identifizieren, die Transformationen sabotieren. Ich unterscheide hier vier zentrale Bias-Typen:
1. Head-Bias
Organisationen planen mit Zahlen, Roadmaps und KPIs. Oft wird aber vernachlässigt, wie Stakeholders das Warum erleben. Entscheidend ist die Sinnstiftung: Werden Emotionen und Identität adressiert, steigt die Chance auf Adoption. Studien zeigen, dass die „Menschen-Seite“ von Change massgeblich über Erfolg entscheidet.
2. Design-Bias
Visuell ansprechende Benutzeroberflächen, Tools oder fancy Rollouts sind nützlich - aber wenn Handhabung, Wartung und Alltagstauglichkeit fehlen, bleiben sie ungenutzt. Gute Gestaltung muss usability-orientiert sein.
3. Strategy-Bias
Strategien werden häufig im Topmanagement entworfen und „nach unten“ delegiert. Die Umsetzung erfordert jedoch Ownership auf allen Ebenen; sonst entsteht ein Disconnect zwischen Entscheidung und Ausführung. Sichtbares Leadership und Beteiligung während der ganzen Transformation sind jedoch essenziell für den Erfolg.
4. Reform-Bias
Viele Organisationen starten zahlreiche Initiativen, ohne Ergebnisverantwortung oder Abschlussmechanismen zu definieren. Das erzeugt Selbsttäuschung: Man fühlt sich produktiv, bewegt sich aber im Kreis.
Diese Biases sind keine unveränderlichen Gegebenheiten.; sie lassen sich mit klaren Interventionen mindern - vorausgesetzt, Führungskräfte nehmen diese unsichtbaren Dynamiken ernst.
Theoretische Anker: Lewin, Kotter, Kübler-Ross - was sie leisten (und wo Grenzen liegen)
Die Change-Lehre bietet eine Toolbox an Modellen, die unterschiedliche Dimensionen sichtbar machen und Orientierung liefern.
Kurt Lewin: Unfreeze - Change - Refreeze
Lewins Dreiphasenmodell betont, dass Systeme «auftauen» müssen, bevor Veränderung möglich ist, und dass nach dem Umlernen eine Stabilisierung notwendig ist. Die Metapher ist nützlich, weil sie die zeitliche Dimension von Veränderung betont: Ohne ein bewusstes Stabilisieren droht ein Zurückfallen in alte Routinen.
John P. Kotter: Acht Stufen des Wandels
Kotters Modell ergänzt Lewin durch operationalisierbare Schritte: von der Schaffung von Dringlichkeit über Vision und Empowerment bis hin zur Verankerung der Veränderung in Kultur und Strukturen. Kotter betont besonders, dass erfolgreiche Veränderungsprozesse eine mächtige Führungskoalition (Guiding Coalition) erfordern, die den Wandel vorantreibt. Die Führungskräfte in dieser Koalition agieren de facto als Sponsoren der Veränderung.
Die Kübler-Ross-Change-Curve
Ursprünglich ein Modell zur Beschreibung von Trauerphasen, wird die Curve oft genutzt, um emotionale Reaktionen auf Veränderung zu erklären: von Schock über Ablehnung und Frustration bis hin zu Akzeptanz. Sie macht deutlich: Menschen durchlaufen emotionale Zyklen, und Change-Management muss die Gefühle, nicht nur die Fakten, adressieren. Da die Curve selbst keine detaillierte Umsetzungslogik liefert, sollte sie komplementär mit konkreten Change-Tools gekoppelt werden.
Kritischer Blick:
Kein Modell ist «die» Lösung. Die Modelle ergänzen sich: Lewin liefert eine Makro-Zeitstruktur, Kotter operative Schritte, die Change-Curve erklärt Emotionen. Entscheidend ist, diese Ebenen synchron zu denken: Strategie, Struktur, Emotionen und Lernen.
Psychologische Sicherheit: Die unterschätzte Komponente für Wandel
Eines der stärksten empirischen Resultate der Team-Forschung ist die Bedeutung psychologischer Sicherheit: Wenn Teammitglieder Risiken eingehen können, ohne soziale Bestrafung zu fürchten, steigt Lernfähigkeit und Performance. Amy Edmondson's klassische Untersuchung zeigt, dass psychologische Sicherheit das Lernen in Teams fördert - ein zentraler Hebel für erfolgreiche Implementierung komplexer Veränderungen. Auch Googles «Project Aristotle» bestätigt, dass psychologische Sicherheit zu den Kernfaktoren effektiver Teams zählt.
Was bedeutet das konkret für Führungskräfte?
Regelmässige Feedback-Routinen, in denen Fehler offen besprochen werden und als Change zur Weiterentwicklung gesehen werden
Führungskräfte, die Fehler zugeben und aktiv nach Input fragen
Anerkennung und celebration kleiner Lernfortschritte
Psychologische Sicherheit ist kein Nice-to-have: Sie wird zur Grundvoraussetzung, damit Mitarbeitende sich auf «experimentelles Arbeiten» einlassen.
Messbarkeit als Orientierung, nicht als Kontrolle
Ziele müssen klar und messbar formuliert werden: SMART-Kriterien sind hier eine bewährte Richtschnur (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). SMART-Ziele schaffen Orientierung, geben eine Objektivität und ermöglichen kontinuierliches Lernen.
Praxisregel: Wähle 3 - 5 Kernmetriken, die direkt mit dem Nutzwert für Kund:Innen oder Prozessqualität verbunden sind. Metriken sollen ausserdem Frühwarncharakter haben, d.h. früh erkanntes Abweichen ermöglicht Gegensteuerung.
Stakeholder-Analyse und gemeinsame Sprache
Transformationsprojekte sind Multi-Stakeholder-Systeme. Eine sorgfältige Stakeholder-Analyse identifiziert Betroffene und Einflussnehmende innerhalb und ausserhalb der Organisation. Sie legt fest, wer wann wie informiert oder involviert wird. Ebenso wichtig ist eine einheitliche Terminologie: Unterschiedliche Teams benutzen öfters unterschiedliche Vokabulare, z.B. sprechen sie von «Meilensteinen», «Wellen» oder «Phasen» - das erzeugt Verunsicherung und Irritation. Eine gemeinsame Sprache reduziert Missverständnisse und Fehler messbar.
Force Field Analysis: Hebel identifizieren und gestalten
Die Force-Field-Analyse von Kurt Lewin visualisiert treibende und hemmende Kräfte. Sie ist pragmatisch: Statt Widerstand als Feind zu betrachten, analysiert sie seine Ursachen (z. B. Angst vor Kompetenzverlust) und identifiziert Interventionspunkte (z. B. gezielte Weiterbildung). Wenn Druck aufgebaut wird, entsteht meist Gegendruck; nachhaltigere Wirkung erzielt man durch Reduktion hemmender Kräfte und Stärkung treibender Kräfte.
Agiles Lernen: Retrospektiven, Experimente, kleine Schritt
Transformationsarbeit profitiert von iterativem Vorgehen: Plan-Do-Check-Act, Retrospektiven und kleine, schnelle Experimente erlauben schnelles Lernen. Agile Methoden verlagern die Perspektive vom «Plan-fest-Betrieb» zum kontinuierlichen Lernen in der Umsetzung. Fehler werden nicht verteufelt, sondern als Informationsquelle genutzt. Das ist eine Kulturentscheidung, die Leadership und Incentives betrifft.
Drei Archetypen des Lernens
Aus der Praxis haben sich drei lernorientierte Archetypen als nützlich erwiesen:
Die Entdecker: Sie treiben Vision und Neugier voran.
Die Experimentatoren: Sie testen, messen und iterieren.
Die Jazz-Musiker: Sie improvisieren und provozieren Perspektivwechsel.
Diese Archetypen helfen, neue Sichtweisen auszuprobieren und ein Umfeld des agilen Lernens zu fördern.
Typische Fehler in der Praxis - und wie man sie vermeidet
Nur eine «Kommunikationskampagne» starten.
Kommunikation ist wichtig, aber ohne Dialog und echte Beteiligung bleibt sie oberflächlich. Lösung: Dialogformate, Roundtables, und Klarheit in der Kommunikation.
KPIs ohne Relevanz.
Metriken, die nur Reporting bedienen, können sogar falsche Incentives setzten. Lösung: Outcome-orientierte KPIs mit klarer Ausgangs-Basis und angestrebtem Zielwert.
Topmanagement ist abwesend.
Sichtbares Sponsoring ist entscheidend; Führungskräfte müssen Zeit in Change-Arbeit investieren.
Widerstand pathologisieren.
Widerstand ist oft ein Signal für ungelöste Interessen oder fehlende Kompetenzen. Lösung: Ursachenanalyse, Weiterbildung, und Beteiligung.
Keine Stabilisierung.
Nach der Einführung fehlt oft die Stabilisation. Etablierung von Routinen braucht Zeit und Incentives (Refreeze).
Ein pragmatisches Vorgehensmodell für Führungskräfte (operativ)
Initiale Diagnose: Kurze Force-Field-Analyse + Stakeholder-Mapping.
Verankerung von Psychologischer Sicherheit: Führungskräfte-Workshops; einfache Verhaltensregeln (z. B. Teamnormen-Workshop, Retrospektiven).
Pilotierung und Quick-Wins: Pilotierung mit einem Team, daraus lernen und Piloten weiter ausrollen. Kleinere, messbare Projekte mit schnellem Erfolg führen zur Steigerung der Motiovation.
Skalierungs-Pattern: Lessons learned in Meeting besprechen und dokumentieren, Sponsorship durch Topmanagement sichtbar halten.
Verankerung / Refreeze: Prozesse, Rollen und Anreizsysteme anpassen; Erfolge feiern.
Kritische Reflexion: Wann sind Modelle nicht genug?
Modelle sind Karten, keine Terrains. Sie helfen, Blindstellen zu erkennen, ersetzen aber niemals Kontextsensitivität. Insbesondere bei hochkomplexen, systemischen Veränderungen (z. B. Kulturwandel über Jahre) braucht es Geduld, iterative Anpassung und die Bereitschaft, Hypothesen immer wieder zu verifizieren. Die «70-%»-Zahl darf nicht zu Fatalismus führen; sie ist ein Weckruf, nicht ein Schicksalsspruch.
Zusammenfassung
Veränderung gelingt dann, wenn Strategie, Struktur und das Unsichtbare - Emotionen, Machtverhältnisse, Lernkultur - synchron bearbeitet werden. Praktisch bedeutet das: treibende und hemmende Kräfte (Force-Field) diagnostizieren, ein Umfeld mit psychologischer Sicherheit erschaffen, relevanten SMART-Metriken als Orientierung einsetzen, iterativ mit Piloten und Retrospektiven arbeiten und sichtbares Sponsorship beziehungsweise Leadership sicherstellen. Nicht die Technik entscheidet letztlich, sondern das menschliche Umfeld, in dem sie nutzbar gemacht wird.
Über die Autorin
Dominique Giger ist Leadership, Mindset und Transformations-Expertin. Als Consultant, Coach und Speakerin mit einem MSc in Computer Science (ETH Zürich) verbindet sie technische Expertise mit Neurowissenschaften, Hypnose und 18 Jahren Erfahrung im internationalen Change- und Transformationsmanagement. Dominique begleitet Führungskräfte und Teams KMUs und Konzernen und fokussiert auf zukunftsorientierte Führung, Resilienz und nachhaltige Kulturveränderung.
🎧 Diese Ausgabe basiert auf Folge #23 ihres Podcasts: Die unsichtbare Seite von Transformation - Tools und Mindset für nachhaltige Veränderung in komplexen Umfeldern
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/folge-23-die-unsichtbare-seite-von-transformation-tools/id1801021329?i=1000734623756
Quellenverzeichnis
Die folgenden Quellen sind im Text zitiert und bieten vertiefende Lektüre:
McKinsey & Company - Changing change management (überblickende Analyse, u.a. die 70-%-Aussage). Online
Edmondson, A. C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly
Kotter, J. P. (1995). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review
Lewin, K. (1947/1951). Arbeiten zur Feldtheorie und Force-Field Analysis; Einführung des Unfreeze–Change–Refreeze Modells. Sekundärbeschreibung: Institute for Manufacturing / Prosci
Prosci - Kübler-Ross Change Curve und Anwendung im Change Management. (Praxisanwendung & Kritik)
Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. Journal of Management Review. (Ursprung der SMART-Kriterien)
Google Project Aristotle / re:Work - Understand team effectiveness (Studie zur Team-Performance; psychologische Sicherheit als Kernelement)
Whatfix / Prosci Artikel zur Anwendung der Kübler-Ross-Curve (Praxisperspektive; 2024/2025)
McCausland, T., et al. (2023). Creating Psychological Safety in the Workplace - Forschung zur Wirkung psychologischer Sicherheit auf Projektteams

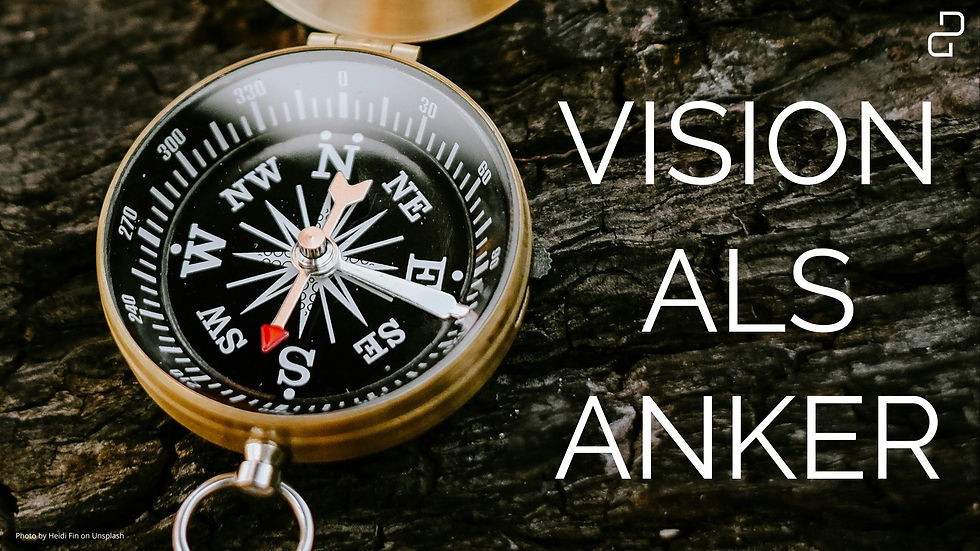





Kommentare